„Wir bekommen von früher Jugend an zu hören, dass es wichtig sei, sich ausdrücken zu können, aber es wird nicht weniger Energie in das Unterbinden von Äußerungen investiert als in die Suche nach sprachlichem Ausdruck.“ (Pos. 1385)
So schreibt es die 1959 in Südafrika geborene und in Großbritannien lebende Autorin Deborah Levy in ihrem 2019 in deutscher Ausgabe im Hoffmann und Campe Verlag veröffentlichten Roman Was das Leben kostet und um nichts weniger als ihr eigenes Leben geht es in eben diesem Werk. Es stellt zugleich den zweiten Teil einer „Living Autobiography“ Reihe dar, welche nicht rückwärts gewandt von ihrem Leben erzählen möchte, sondern in der Gegenwart. Insgesamt ist so eine Trilogie entstanden, deren erster Teil den Titel Was ich nicht wissen will trägt und mit Ein eigenes Haus ihren Abschluss findet.
In Was das Leben kostet folgt der Lesende aber keiner zwingend stringenten und lückenlosen Handlung, sondern wird langsam auf die biografische und literarische Verarbeitung vor allem zweier großer Themen hingeführt, die letztlich die Frage nach einem dritten und den Roman umspannenden Aspekt bereiten. Erstes zentrales Thema der 50 jährigen Protagonistin ist zunächst das Scheitern und die Trennung einer langjährigen Ehe, die sie mit einem Schiffbruch gleichsetzt. Es ist dieses Schwimmen und der feste Grund auf dem sie stehen kann, der ihr verloren gegangen ist und zu neuem Denken und dem Wunsch führen, ein Leben, das außerhalb gängiger Konventionen liegt, zu gestalten. Eine Vorstellung die, wie sich herausstellt, nicht ohne das Aufbrechen noch immer gängiger Geschlechterrollen und Klischees von Mutterschaft und Häuslichkeit möglich ist. Denn während ein vormals liebevoll eingerichtetes Heim langsam ausgeräumt und wieder in seine Einzelteile zerlegt wird, zeigt sich:
„Wenn vom Märchen des schönen Heims, in dem Glück und Behagen von Mann und Kind immer vorgehen, die Tapeten abgerissen werden, kommt dahinter eine unbedankte, ungeliebte, vernachlässigte, erschöpfte Frau zum Vorschein.“ (Pos. 122)
Eine Beschreibung die noch weit über die Kritik an der patriarchalischen Vater-Mutter-Kind-Vorstellung hinausreicht, in der die Frau diejenige ist, die sich um den Nachwuchs und das Heim kümmert. Denken wir nur daran, wie uns dieser Tage wieder allzu oft gewahr wird, wie viel unbezahlte Arbeit Frauen vor allem im sozialen und privaten Umfeld leisten, wenn es beispielsweise um die Betreuung Angehöriger geht und es geradezu vorausgesetzt wird, dass der Mann weiter seinen Beruf ausübt, während die Frau ihren Anspruch auf beruflichen Erfolg gegen die Rolle der Kümmerin eintauschen muss. Und dennoch werden viele Kinder ihrerseits das alte Ideal – so möchte ich es einmal nennen – nach Meinung der Autorin eines Tages wieder anstreben.
Für unsere Protagonistin ergibt sich mit ihrem Umzug – nach Nordlondon in den sechsten Stock eines abgerockten Wohnblocks – noch ein weiteres Problem. Zwar hat sie für sich und ihre Töchter wieder ein Dach über dem Kopf, aber ein Platz für sie zum Arbeiten, genauer gesagt zum Schreiben, fehlt ihr. Eine Thematik die mich fast unweigerlich an Virginia Woolfs Ein Zimmer für sich allein erinnert hat, in dem sie bereits fast 90 Jahre vorher die Wichtigkeit und die Notwendigkeit eines privaten Raumes beschreibt, den auch Frauen benötigen, um kreativ und schöpferisch tätig sein zu können. Umso absurder erscheint in diesem Zusammenhang, dass Frauen, die ja oftmals die so genannten “häuslichen Pflichten” übernehmen, in diesem Kontext einen solchen Raum meist nicht für sich in Anspruch nehmen können. Aber wir haben Glück, unsere Protagonistin findet in Form eines kleinen Gartenhäuschens eine Möglichkeit ungestört ihrer Arbeit nachgehen zu können und wir spüren, wie unter die bodenlosen Füße allmählich wieder etwas Halt gerät.
Ein zweites zentrales Thema des Romans ist der Tod der Mutter. Sie erkrankt nur ein Jahr nach dem Umzug der Protagonistin nach Nordlondon an Krebs. Es ist aber nicht nur die Geschichte eines Abschieds, sondern auch die Reflektion über ihre Mutter und Mutterschaft an sich. Wünschen wir uns Mütter die mit beiden Beinen fest auf dem Boden stehen, um sie am Ende zu verspotten, dass sie keine Träume haben, während die Väter hinaus in die Welt ziehen und den Helden spielen dürfen? Deborah Levy beschreibt sowohl eigene Erfahrungen als auch allgemeine Gedanken, die geprägt sind von widersprüchlichen und doch zusammengehörenden Gefühlen wie der Wunsch nach Abgrenzung und der gleichzeitigen Sehnsucht nach der eigenen Mutter. Aber auch das Erkennen und Anerkennen dessen, was die Mutter in ihrem Leben geleistet hat, die nachträgliche Bewunderung dafür und vielleicht auch die Trauer darüber, es erst so spät erkannt zu haben. Und letztlich schreibt Deborah Levy vom Abschied. Den letzten Tagen mit der Mutter und der Zeit danach, die sich für die Protagonistin anfühlt, als hätte sie mit der Mutter gleichzeitig ihr inneres Navigationssystem, ihre Orientierung verloren und dem damit einhergehenden Wunsch, mehr aus ihrem Leben machen zu wollen als bisher.
Durch diesen beiden zentralen Themen entwickelt Deborah Levy ein drittes und den Roman umspannendes Thema in dem es um die Rolle der Frau im Allgemeinen geht. Wie es möglich ist in unserer Gesellschaft ein selbstbestimmtes und unabhängiges Leben zu führen oder den Weg konventioneller und erwarteter Pfade zu verlassen. Nicht ohne Grund finden sich daher immer wieder Verweise auf andere Autorinnen wie Simone de Beauvoir oder Marguerite Duras, mit denen sie sich eingehend befasst zu haben scheint und die ihr helfen, ihren eigenen Platz zu finden. Es wird deutlich, dass der Preis für Unabhängigkeit auch Unannehmlichkeiten bedeutet und es nötig ist, den Mut dafür aufzubringen, diese in Kauf zu nehmen. Levy schreibt aber nicht nur todernst, sondern kombiniert die nachdenkenswerten Komponenten auch mit witzigen Episoden und scharfsinnigen Beobachtungen.
Daraus entsteht, wie eingangs erwähnt, kein durchkomponierter Roman der einer strengen Form folgt oder zeitliche Abfolgen exakt einhält, sondern eher eine Mischung aus Reflektion und Wiedergabe der eigenen Biografie in der sie nach Antworten auf Fragen sucht, die sie tief bewegen. Ebenso greift sie auf bereits Vorhandenes zurück, analysiert es, bekräftigt es für sich selbst oder stellt es in Frage. Und trotz aller Zweifel die mit diesen Gedanken einher gehen, wird doch deutlich, dass Deborah Levy oder ihre Protagonistin stellvertretend für sie, den Willen hat, sich ein Leben, wie sie es sich wünscht, nämlich selbstbestimmt und nicht in vorgefertigten Rollenbildern, zu erarbeiten, ohne sich durch andere Zweifel einreden zu lassen. Sie selbst schreibt in ihrem Buch: „Freiheit ist nie umsonst. Wer je um Freiheit gerungen hat, weiß was sie kostet.“ (Pos. 174)
Ein wunderbares Buch, das ich nur wärmstens empfehlen kann und das auf gerade einmal etwas mehr als 100 Seiten sehr viel Nachdenkenswertes in sich birgt.
In der nächsten Woche bespricht Irmgard Lumpini "Wer hat meinen Vater umgebracht" von Édouard Louis.





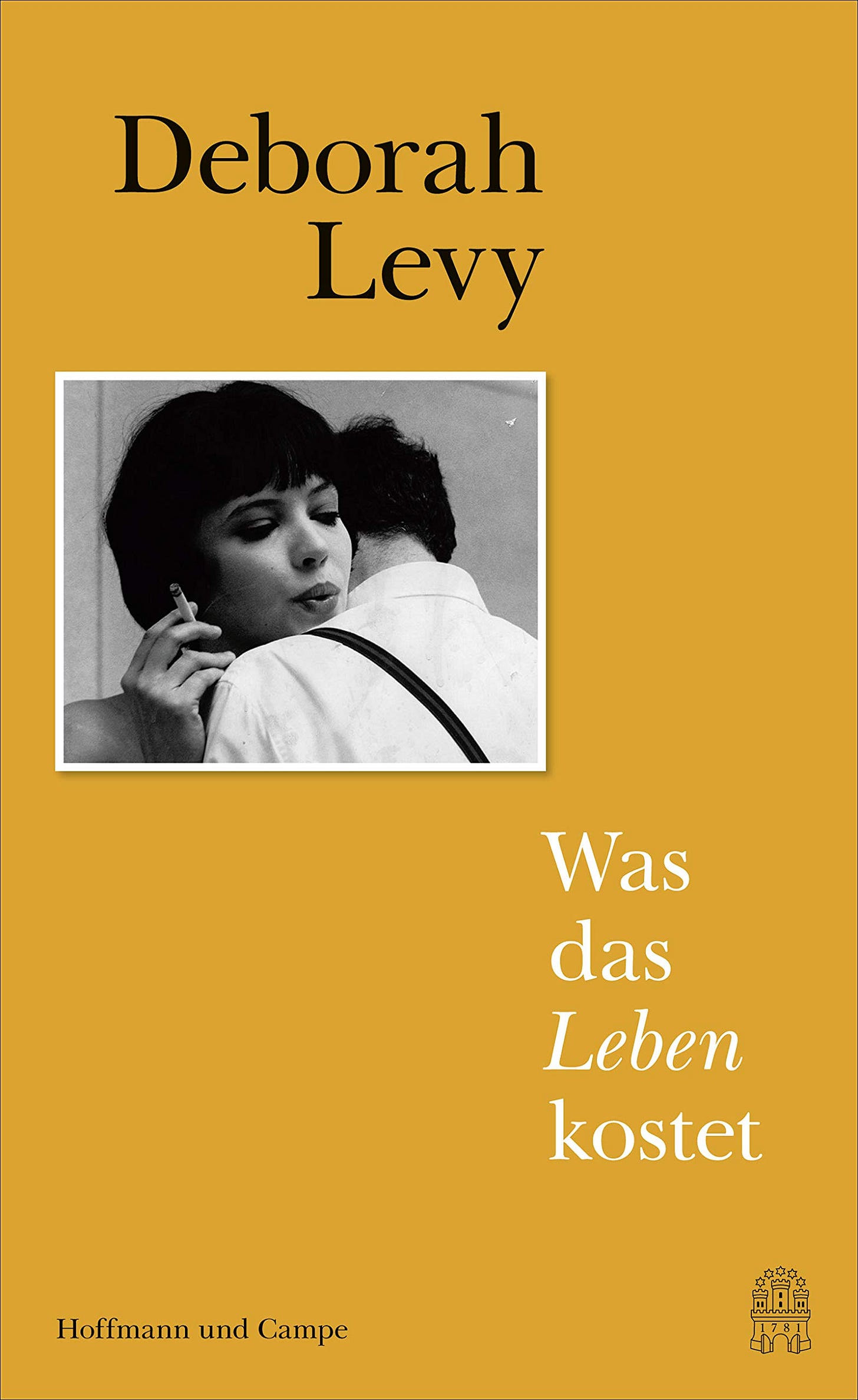








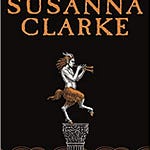
Share this post