Ob Als oder Wie oder Wie als ob: Die Schönheit des Dahliengartens.
Korrekte Sprache, die Kartographie unserer Gefühle und ob das nun wichtig ist oder nicht.


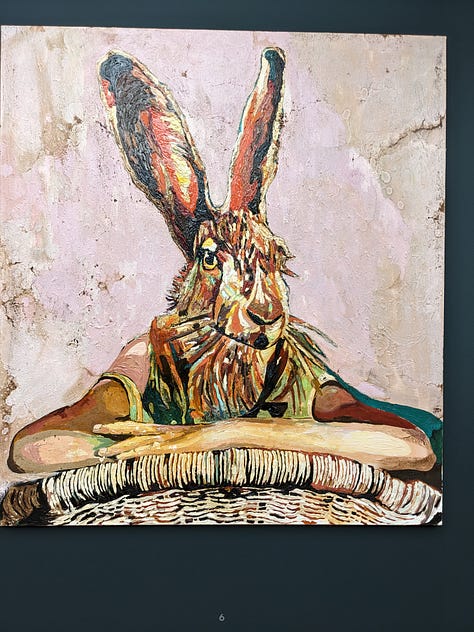






Liebe Leserinnen und Leser,
da trafen sich die Brigademitglieder Anne Findeisen und Herr Falschgold zufällig in einem Trinklokal ihrer Wahl und sprachen über die regelgerechte Verwendung von “als” und “wie” und ob man da freizügig sein kann oder nicht und ob es Schmerzen bereitet oder nicht oder oder oder und und und. Und wer die Regeln bestimmt. Und wie wichtig das ist.
Bevor ich hier ein Loblied der sprachlichen Veränderung, Transformation und des Laissez-faire und überhaupt singe, möchte ich gestehen, dass es sprachliche Eigenheiten und Entwicklungen gibt, die mich auch schon den Fernseher anschreien ließen: Es heißt ZU Weihnachten & ZU Ostern, nicht AN Pfingsten! Natürlich hat jetzt jede und jeder gedacht: Es bringt relativ wenig, den Fernseher anzuschreien. Richtig.
Und es sollte scheißegal sein. Sprache und ihr Gebrauch - über dessen Korrektheit sehr unterschiedliche Institutionen wie Familie, Herkunft, Universität und Gesellschaften bestimmen - bringen zunächst erstmal einen Distinktionsgewinn: Ich weiß, wie das geht. Ich weiß, wie es richtig ist.
Der korrekte Gebrauch der Sprache und ihrer jeweiligen Feinheiten sind die Aufstiegsmöglichkeit der Mittellosen. Um zu wissen, wie man korrekt Lobster entschalt, braucht es entweder Übung, einen persönlichen Kellner oder YouTube Videos. Für die korrekte Sprache bzw. dessen, was man dafür hält, muss man sich darauf einigen, was man dafür akzeptieren möchte: ist es die Schulbildung? Ist es die Universität? Das Feuilleton? Der Verein der deutschen Sprache1?
Nur damit wir uns nicht falsch verstehen: die regelgerecht gebrauchte/geschriebene Sprache hat durchaus Vorteile, wenn sich zum Beispiel ein Text einfacher erfassen lässt.
Aber wie wichtig ist ein Standard und für wen?
Jede Gruppe, jedes Dorf, jede Schicht, jeder Beruf bringt eigene Sprachentwicklungen. Die Welt ändert sich, die Sprache ändert sich. Sie ändert sich auf der Straße, in den Clubs, auf den Meeren und Wegen.
In der Literatur wird so etwas auch mal (zurecht) als “kühn” gefeiert. Wenn es jemand versucht (oder einfach macht), der*die nicht aussieht, als hätte das Outfit mindestens das Dreifache des monatlichen Bürgergelds gekostet, wird es schlicht als FALSCH gebrandmarkt.
Herr Falschgold nannte das Wort “Hals” als ihm unangenehm, ich werfe mal den “Nationalstolz” hinterher.
Oder auch die “BILDUNG”. Manchmal hört man in (fremden) Gesprächen Unverständnis darüber, dass jemand irgendetwas nicht kennt, nicht gelesen, nicht gesehen hat, mit einem Duktus der Empörung. Ein Raunen über einen Kanon, der eine bestimmte Bildung zeigt oder zeigen soll, der aber in den letzten Jahren gehörig ins Wanken gekommen ist:
Wer bestimmt? Wer wird gezeigt, was wird ausgeklammert, ignoriert, verschwiegen?
Interessant wird es, wenn Neuschöpfungen von Worten Leerstellen beschreiben oder umfangreiche Konzepte vorstellen, z. B. Gojnormativität.
Sprache bestimmt das Bewusstsein, klar: da können sich viele gegen das Gendern stemmen und haten, es ändert nichts daran, dass Menschen andere Bilder vor ihrem geistigen Auge sehen, wenn alle mitgenannt werden.
Und natürlich gibt es nie genug Sprache, die uns Selbsterkenntnis und Kommunikation ermöglicht, die diesen Namen verdient: Fix, wie viele der 87 von Brené Brown genannten Gefühle könnt ihr benennen? Und erkennt sie bei euch selbst?
Natürlich ist jede Sprachdiskussion bei Studio B willkommen und angebracht, Literatur wird nun einmal aus Zeichen geklöppelt, gezimmert und geschraubt. Im Fall von ALS und WIE finde ich es vernachlässigbar (Ist das ein existierendes Wort?2).
Hier noch eine Tiktok-Empfehlung, die - richtig angewendet - die Toleranz für Sprachentwicklungen nach oben schraubt: Prof. Simon Meier-Vieracker.
Aber bevor ich meinen Senf (auch ein sehr gutes Thema für unsere freie Rubrik) zu ALS und oder WIE dazugeben musste, stand mein Thema schon fest: Wie wunderschön ist eigentlich der Dahliengarten im Großen Garten? Sehr, exorbitant und überhaupt scheißgeil.
Nicht allen Dresdner*innen ist er bekannt und überhaupt ist das ja eines der wirklich wichtigen Themen: Wie sehr lebt man in ihrer Stadt? Wieviel weiß man darüber? Wie empfindet man diese? Und warum wissen Touristen, wenn sie erstmal im Zwinger gewesen sind und noch 3 Tage Zeit haben, soviel mehr über Dresden? (Das war eine rhetorische Frage, klar).
Vor einigen Jahren erstand ich in Bristol in einem Museumsladen ein Buch: “How To Live in The City”. Wer keine Selbsthilfebücher mag, ist sehr arrogant oder zu faul zum Lesen und hat Angst vor Veränderungen und Verantwortung und begründet dass mit seiner Kritik am “spätkapitalistischen Optimierungswahn” (da ist natürlich auch was dran, aber das ist heute nicht das Thema).
Jedenfalls gebe ich mir seitdem Mühe, etwas mehr über die Stadt zu erfahren, in der ich lebe. Eine Empfehlung (no Ironie!) sind an dieser Stelle die Pressemitteilungen der Stadt.
Aber zurück zum Dahliengarten. Lauft oder fahrt dahin, freut euch an den prächtigen Pflanzen und Blüten, lacht über die hübschen Namen, werdet blöde beim Versuch eine Lieblingsdahlie zu finden. Spaziert weiter durch den Großen Garten, in dem sich viele wundersame Dinge finden und gönnt euch frisches Gemüse oder schickes Wachstuch, falls ihr an einem Freitag im Park sein solltet und danach auf den Markt am Hygienemuseum gehen könnt.
Auf gar keinen Fall. Die Verwendung der deutschen Sprache ist deren kleinstes Problem.
